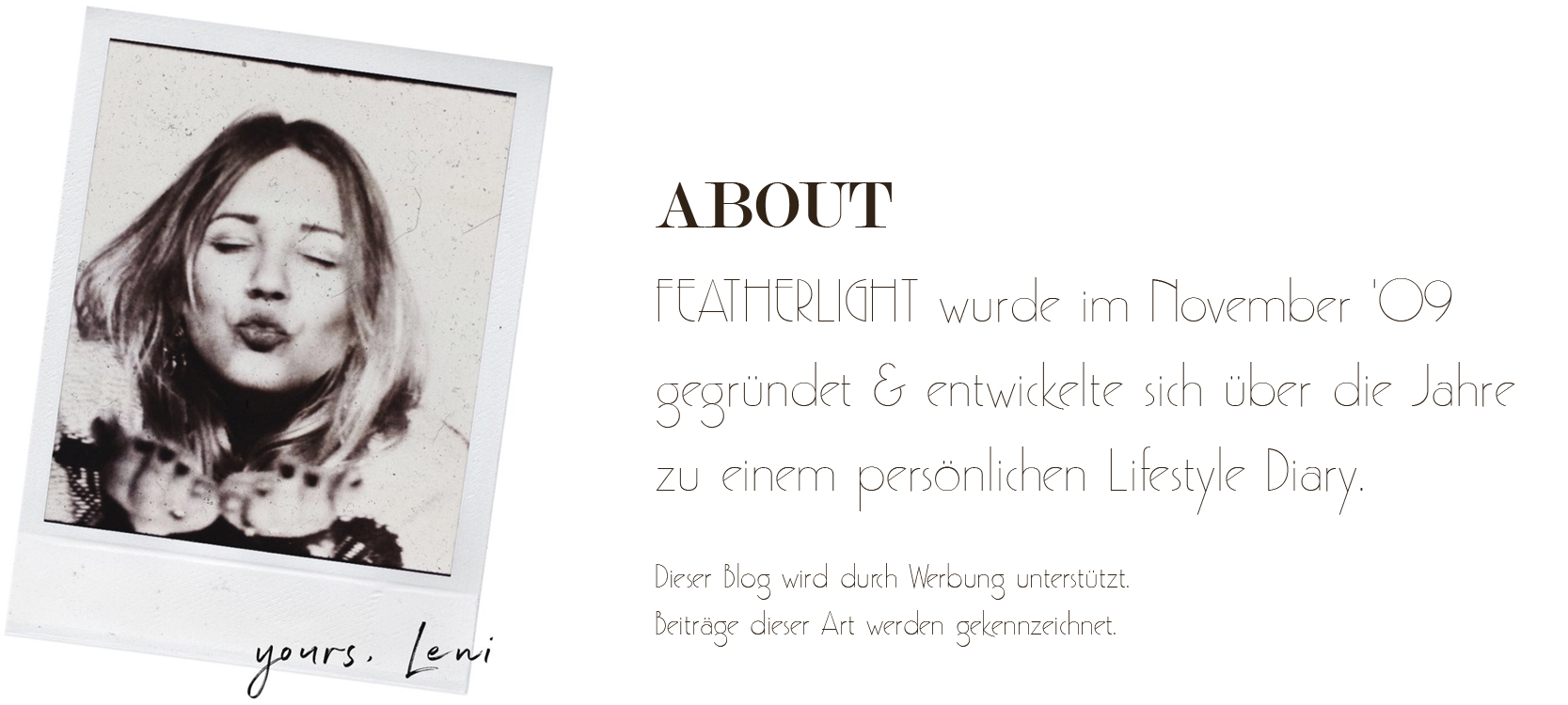Ich habe diesen Beitrag bereits im November 2021 angefangen zu schreiben und ihn dann doch links liegen lassen. Es war wohl noch nicht der richtige Zeitpunkt. Doch bereits in den letzten Tagen habe ich wieder häufiger an den Entwurf dieses Textes gedacht und jetzt fühle ich mich bereit. Ich war in einer psychosomatischen Klinik und es war die beste Entscheidung die ich für mich treffen konnte.
Die, die mir auf Instagram folgen oder auch meinen Blog schon länger lesen wissen, dass ich schon seit vielen Jahren mit Depressionen zu kämpfen habe. Da es eine rezidivierende Depression ist kehrt sie, wie der Name schon sagt, immer wieder zurück. Sie kommt manchmal in Wellen, manchmal stärker, manchmal schwächer. Auch wenn es sich im ersten Lockdown 2020 bereits angebahnt hatte, dass meine Psyche die gegenwärtige Situation nicht ganz gebacken bekommt; im Frühjahr 2021 zwang sie mich in die Knie.
Nach meinem anfänglichen Neujahrshoch merkte ich vergangenes Jahr schnell, dass das Leben - so dramatisch es nun klingt - schwerer fällt als gewöhnlich. Ich projizierte es wochenlang auf die Arbeit, doch als ich mir eine Pause 'gönnte' merkte ich, dass die Arbeit nur Mittel zum Zweck und Kompensation war. Nach dem Realisieren ging es mir die ersten Wochen wirklich schlecht. Ich konnte kaum schlafen, war dementsprechend den ganzen Tag müde; mein Körper schmerze, ich hatte keinen Appetit, weinte viel und hatte mit Panikattacken zu kämpfen. Diese kamen, wie ich dachte, vom Weltschmerz den ich zu dieser Zeit vermehrt empfand. Alles, was auf der Welt zusätzlich zu Covid-19 passierte, waren mehrheitlich schlechte Nachrichten und sie ängstigten mich. Ich machte mir Gedanken über die Zukunft, über mein Leben und das Leben der Kinder, die ich noch in diese Welt setzen wollte. Auch toxische Familienverhältnisse und die Frage "Muss ich an etwas fest halten, das mir nicht gut tut, nur weil es Familie ist?" beschäftigte mich oft Tag und Nacht.
Als ich dann über meine Ängste, Gedanken und Panikattacken mit meiner Ärztin sprach erhielt ich zusätzlich zur rezidivierenden Depression die Diagnose Angst- und Panikstörung. Eine weitere psychische Störung - auch wenn ich finde, dass Störung ein sehr negativ behaftetes Wort ist, trifft es das doch sehr gut. Und es erklärte sich mir einiges. Mit dieser Diagnose war mir auch klar: ich brauche Hilfe und zwar in Form einer stationären Behandlung. Keine acht Woche nach Antragstellung hatte ich die Genehmigung der Rentenkasse für einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik und vier Wochen später ging es auch schon los.

Der Alltag in einer psychosomatischen Klinik
Die ersten paar Tage in der Klinik ging es mir wirklich nicht gut. Auf Grund der pandemischen Lage musste ich für knapp 36h in Isolation – da war ich also, in einer neuen Umgebung, in einem fremden Zimmer, wissentlich, dass dies für die nächsten fünf Wochen mein „Zuhause“ sein würde. Ich vermisste mein Bett, meinen Freund, meine gewohnte Umgebung, einfach alles. Bereits in den ersten zwei Tagen war mir klar: sollte ich eine Verlängerung erhalten werde ich dieses auf keinen Fall annehmen – ich wollte so schnell als möglich wieder nach Hause. Dieser „Zustand“ besserte sich, nachdem die Quarantäne überstanden war, ich mich wieder aus meinem Zimmer bewegen durfte und allmählich auch andere Patient:innen kennenlernte. Trotzdem gehörten die ersten 2,5-3 Wochen nur mir. In der freien Zeit zwischen oder nach den Therapiesitzungen las ich viel, ging 2-3h spazieren und machte Sport. Jeden Abend schrieb ich in mein Therapietagebuch, lies Sitzungen und Gespräche mit anderen Patient:innen Revue passieren. Und ich merkte, wie ich allmählich ankam und auch irgendwie wieder zu mir selbst zurückfand.
Das war es auch, was ich in der Klinik begriff: die Verbote, nicht mehr in der Stadt zu bummeln, Cafés trotz schönen Wetters zu besuchen oder sich mit Freunden draußen zu treffen, die ich mir selbst auf Grund meines Krankenstatus auferlegt hatte, trugen dazu bei, dass kein Weg an einer stationären Einrichtung vorbei führte. Denn diese „Verstärker“, wie man im Fachjargon die Dinge nennt, die psychisch kranken Menschen gut tun und Aufwind geben, haben mir dadurch gefehlt. Daher auch an dieser Stelle mein Appell an alle, die wie ich mit der mentalen Gesundheit struggeln:
Auch wenn es sich für euch an manchen Tagen so anfühlt: ihr seid nicht bettlägerig
Geht raus und tut die Dinge die euch gut tun, mit Menschen die euch gut tun!
Und wenn es dir gut tun würde in den Urlaub zu fliegen: dann flieg in den Urlaub!
Bis auf die Bewegungstherapie, die an der frischen Luft oder im Schwimmbad stattfanden, hatten wir überall die Pflicht, Masken zu tragen; je nach Inzidenz eine medizinische oder FFP-2 Maske. Gerade bei sportlichen Aktivitäten in der Halle oder Yoga natürlich ganz schön anstrengend. Im Speisesaal, in dem wir auch in Gruppen zur Entzerrung aufgeteilt waren, durften wir nur am Platz die Maske ablegen; am Buffet mussten wir Handschuhe tragen. Für die Maßnahmen bin ich im Nachhinein dankbar, denn die Klinik musste vorher schon zwei Mal wegen Quarantäne schließen; einer meiner Mitpatienten war bereits zum vierten Mal da, da er seinen Aufenthalt pandemiebedingt die Male davor nicht abschließen konnte. Eine zusätzliche psychische Belastung, wie ich finde.

6 Wochen „Fernbeziehung“
Was mir am stationären Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik besonders schwer fiel? Ganz klar: der Abstand zu Felix. Vor allem bedingt durch die Aneinanderreihung diverser Lockdowns haben wir die letzten zwei Jahre quasi 24/7 miteinander verbracht, da sind sechs Wochen (zumindest meiner Meinung nach) schon ein krasser Cut. Aber sie hat uns nur stärker gemacht. Das Vermissen war zwar schmerzhaft und fiel uns beiden oft schwer, aber die Vorfreude auf den alle zwei Wochen anstehenden Wochenendbesuch und das „verliebte High“, wenn das Wochenende dann endlich da und wir wieder zusammen waren hat mir immer wieder neuen Antrieb gegeben und mich gepusht. Außerdem empfinde ich eine tiefe Dankbarkeit. Eine:n psychisch erkrankte:n Partner:in zu haben ist nicht leicht und auch wenn es hart klingt, kann ich verstehen, dass manche Beziehungen genau daran zerbrechen. Und genau deshalb bin ich so dankbar, denn auch meine Beziehung hat schon unter meiner Erkrankung gelitten; nicht gerade wenig. Ich bin dankbar, denn auch wenn es nicht immer leicht für meinen Freund ist, steht er hinter mir. Er versucht mich zu verstehen, mich zu unterstützen und auf mich aufzupassen. Durch den Klinikaufenthalt gehen wir bedachter miteinander um, unsere Beziehung ist ruhiger und konstruktiver geworden. Klar fliegen zwischendurch auch mal die Fetzen, das gehört aber auch dazu wie ich finde. Wir sind einfach an dieser ganzen „Situation“ gewachsen – jeder für sich und wir gemeinsam!
Die Sache mit dem Selbstwert und der Selbstwahrnehmung
Eines der Dinge, die mir in der Klinik schmerzlich bewusst wurden, war zu Begreifen, warum mein Selbstwert und meine eigene Selbstwahrnehmung so angeknackst oder teilweise gar verzerrt waren. Über Jahre wurde mir immer wieder signalisiert, dass ich oder meine Art nicht richtig seien. Vor allem aus dem Kreise der Familie in dem man sich eigentlich geborgen und verstanden fühlen sollte. Ich habe lange nicht gesehen, dass ein stetiger Liebesentzug und Ignoranz, mit dem ich abgestraft wurde, weil ich war wie ich bin, einen großen Teil zu meiner Krankheit beigetragen hat. Ich bin ein ehrlicher Mensch, sehr harmoniebedürftig und spreche trotzdem an, wenn der Schuh drückt. Schwierig wird es jedoch, wenn Ehrlichkeit und die Dinge anzusprechen mit Arroganz, Überheblichkeit und/oder Unverschämtheit verwechselt wird. Und das wurde es oft. Das Resultat daraus war, dass ich phasenweise über mehrere Wochen oder gar Monate behandelt wurde, als wäre ich nicht existent. Und so etwas trifft und es bilden sich Risse im Fundament des Selbstwerts.
Hier hat mir die Klinik einen enormen Schritt weitergeholfen. Meine Freundin K., die mich auch aus der Klinik abholte, sagte zu mir, man sehe mir richtig an wie sehr ich gewachsen und von mir selbst wieder überzeugt sei. Balsam für die Seele. Daran „schuld“ sind meine Mitpatienten. Man trifft in einer psychosomatischen Klinik auf viele verschiedene Menschen, mit denen man viele verschiedene Berührungspunkte hat. In der einen Woche kommen neue Patienten hinzu, während andere ihre Reise beenden. Egal wen ich traf, mit wem ich sprach oder auf wen ich während der Sitzungen wirkte: ich bekam immer wieder gesagt und auch zu spüren, dass ich genau so gut sei, wie ich bin. Diese Leute schätzten meine ehrliche Art, denn auch in der Klinik brachte ich zum Ausdruck, wenn etwas nicht passte. Sie liebten meine fröhliche Art und mein Lachen. Nicht nur einmal hörte ich, wenn es mal wieder an der Zeit war sich zu verabschieden, wie schade es doch sei, nicht noch mehr Zeit mit mir verbringen zu können. Ich brachte den Leuten mit den Gesprächen Mehrwert und das rührt mich noch heute, wenn ich darüber nachdenke.
Ich habe verstanden, dass dich nicht jeder mag – so wie du nicht jeden magst. Das ist menschlich und ganz normal. Ich habe aber auch verstanden, dass es absolut in Ordnung ist, sich von Menschen zu distanzieren, die dir nicht gut tun – egal ob es Bekannte, Freunde oder Familie ist. Und ich habe verstanden, dass ich OKAY bin, wie ich bin. Natürlich kann man sagen „Glaub nicht alles, was du hörst“, vor allem im Bezug auf das Feedback meiner Mitpatienten. Ich denke wir kennen sie alle: Höflichkeitsfloskeln und Komplimente, die nur dazu dienen, um sich einzuschleimen. Aber das ist hier anders. In der Klinik hat niemand etwas davon, derartige Dinge zu sagen, ohne dass sie ehrlich und aufrichtig sind. Man tritt diese Reise über einen kürzeren oder längeren Zeitraum miteinander an, dennoch reist jeder auch für sich und hat demnach nichts davon, anderen Honig ums Maul zu schmieren oder aus Komplimenten seinen Vorteil zu ziehen. Daher sehe ich diese Art der Worte als Aufrichtig und Ehrlich.
Hier denke ich an Sabine zurück, die mich von Anfang an verunsichert hatte, denn ich wusste nie, woran ich bei ihr war. Sie war freundlich, aber zurückhaltend; manchmal fühlte ich mich von ihr beobachtet und ich konnte nicht unterordnen, ob sie mich mit Neugier oder Argwohn ansah. Es müsste meine dritte Woche in der Klinik gewesen sein, als sie abreiste. Nach unserer letzten gemeinsamen Therapiestunde nahm sie mich zur Seite, legte ihren Arm auf meinen und sagte: „Lena, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Kannst du bitte immer so bleiben wie du bist? So ein aufrichtiger und liebenswürdiger Mensch, so ein Sonnenschein? Du darfst nie vergessen, dass die Leute nur dann schlecht über dich reden, weil sie dich beneiden. Sie beneiden dich dafür, dass du du bist, weil du etwas an dir hast, was nicht viele haben.“ Diesen Satz rufe ich mir immer wieder hervor und er beflügelt mich.
WIEDER ZUHAUSE
Nach sechs Wochen (ich habe die Verlängerung natürlich doch nicht ausgeschlagen!) wieder zuhause zu sein war für mich ganz schön überwältigend. Die ersten beiden Tage habe ich mich komischerweise wie ein Gast in meiner eigenen Wohnung gefühlt. Meine „Klinik Bubble“ zu verlassen und wieder in den turbulenten und rücksichtslosen Alltag zu starten habe ich mir in der Tat auch einfacher vorgestellt. Bereits an meinem ersten Wochenende zuhause war ich zwei Mal einer Konfrontation ausgesetzt, die beide Male eine Panikattacke in mir auslösten. Dankbar bin ich hier für meinen Partner, der beide Situationen erkannt hat und diese somit nicht alleine bewältigen musste.
Aber das ging vorbei… von Woche zu Woche zuhause wurde es besser, denn ich gab mir selbst Zeit. Ich sagte kaum jemanden Bescheid, dass ich wieder zuhause war, ließ auch Social Media Social Media sein – wie ich es während meiner kompletten Klinikzeit auch schon gehalten hatte. Keine Ablenkung von außen – volle Konzentration auf mich und mein Innerstes. Ich wollte in meinem Tempo zuhause ankommen und mich auch in meinem Tempo mit den Dingen auseinandersetzen. Außerdem – und das hätte ich nie zu denken gewagt – habe ich die Klinik und die Leute, mit denen ich dort meinen Tag verbracht habe, unwahrscheinlich vermisst. Ja, ich hatte richtig Heimweh nach meiner Klinikfamilie.
Dank dem Klinikaufenthalt bin ich aus mir und meiner psychischen Erkrankung schlauer geworden. Es ist nicht nur meine Erkrankung, sondern auch die Psyche und die Depression an sich, die ich nun besser verstehe. Andere haben eine Stoffwechselerkrankung in der Leber oder Schilddrüse – ich habe sie im Hirn. Es ist eine Krankheit, keine Schwäche! Auch wenn ich viele meiner Ängste noch nicht greifen kann, verstehe ich besser, wodurch sie ausgelöst wurden und damit kann ich arbeiten. Ich habe eine fantastische Psychologin gefunden, die mich fördert und fordert. Die mit mir gemeinsam über den Tellerrand und tiefer in mich hineinblickt, als irgendjemand jemals zuvor. Und dadurch erkenne ich auch meine eigenen Grenzen besser und stehe für mich und meine Gefühle ein, wenn diese Grenzen überschritten werden. Ein Klinikaufenthalt bedeutet nicht gleich Heilung auch wenn viele denken, danach sei man wieder „gesund“. Auf einen Klinikaufenthalt hin folgt Arbeit und ein Prozess, der mit Sicherheit nicht einfach sein wird. Aber er ist es wert!
Und wie geht es nach der psychosomatischen Klinik weiter?
Uff, die Frage habe ich mir häufig gestellt und da ich lange Zeit dabei nur leere im Kopf hatte, habe ich die Frage auch lange vor mir hergeschoben. Ich war noch nicht bereit für Entscheidungen: zurück zum alten Arbeitgeber, zurück in die alte Branche oder etwas Neues wagen? Erst acht Wochen, nachdem ich die Klinik verlassen hatte, hatte ich auch eine Antwort auf die Frage. Ich werde im Frühjahr 2022, also nach knapp einem Jahr im Krankenstand, mit einer Wiedereingliederung starten, denn auch hier möchte ich ein langsames Tempo fahren, um besser auf mein Inneres hören zu können. Und ich habe den Wunsch geäußert meine Stunden zu reduzieren, damit ich mich weiterhin um mich kümmern kann. Ich weiß, dass das eine privilegierte Lage ist, nicht jeder lebt in einer Partnerschaft und/oder in einem geteilten Haushalt. Ich entscheide mich hier bewusst für mich, stehe für mich, meine Gefühle und meine Gesundheit ein. Denn auch das ist ein Learning, das ich aus der psychosomatischen Klinik mitgenommen habe:
ICH muss für mich an allererster Stelle stehen, denn wenn im Flugzeug die Sauerstoffmasken benötigt werden, muss ich MEINE zuerst aufsetzen, bevor ich anderen helfen kann. Denn wenn ich das Bewusstsein verliere, kann ich niemanden mehr helfen. Ich finde diese Metapher sehr treffend, denn wenn wir immer alles und jeden an oberste Stelle und somit VOR uns stellen, verlieren wir uns selbst im Laufe der Zeit.